Dein Warenkorb ist gerade leer!
Leseprobe »Der Gefangenentransport«
Dieses Kapitel ist einer Kurzgeschichte nachempfunden, die ich in den Siebzigern in einer Anthologie gelesen und leider wieder verloren habe.
Mein Name ist Warg Bolton und heute beginnt mein Dienst. Ich schwebe mit meinem Gepäck vor der Andockschleuse. Neben mir befindet sich mein Arbeitspartner Herb. Sein wirklicher Name ist für menschliche Zungen unaussprechlich. Wir zwei werden in den nächsten sechs Monaten das Schiff betreuen, auf das wir gerade zentimeterweise zusteuern. Durch eine verglaste Luke sehen wir seinen Namen vorbeiziehen: HARKONNEN.
Es handelt sich um einen Transporter. Sehr offensichtlich älterer Bauart. Wie sich hier draußen im Vakuum Rost bilden kann, wird mir immer ein Rätsel bleiben. Außerdem sieht es so aus, als wären bei den letzten Reparaturen nicht mehr die passenden Ersatzteile verfügbar gewesen und man hätte sich mit dem beholfen, was gerade so herumlag. Windschnittig muß solch ein Schiff nicht sein. So ähneln dann manche Frachter gegen Ende ihres Lebens, das durchaus 100 Jahre dauern kann, mehr und mehr einem Haufen Altmetall, scheinbar nur noch von der eigenen, geringen Schwerkraft zusammengehalten und beim winzigsten äußeren Anstoß zum Auseinanderdriften bereit.
Die HARKONNEN transportiert eine besondere Fracht: Gefangene. Sie hat die Aufgabe, Verbrecher, die irgendwo in der Galaxis aufgegriffen wurden und gegen die ein galaktischer Haftbefehl vorliegt, zu ihren jeweiligen Heimatplaneten zurückzubringen, wo sie dann abgeurteilt wurden. Ich persönlich finde, daß der Name des Schiffes seine Funktion hervorragend widerspiegelt. Das Lesen antiker Literatur ist eines meiner wenigen Hobbys. Es hilft mir über die langen Stunden hinweg, in denen ich Wache auf der Brücke halten muß.
»Ich krieg kalte Füße!« Herb stammt von einer Welt im Orion-Sektor, die ein größtenteils tropisches Klima aufweist, noch wärmer als die Erde nach dem Klimawandel in den 2.100er Jahren. Deswegen friert er schnell. Vor allem bei der Vorstellung, daß ihn nur ein dünnes Schott von der Kälte des Weltraums trennt.
»Ich hab Dir schon immer gesagt, daß du Socken anziehen sollst«, frotzele ich zurück. Bei der Größe seiner vier mit Haftorganen besetzten Füße ist das eine lustige Vorstellung. Zumindest für mich.
»Du mich auch!«
Herb und ich kennen uns seit vielen Jahren und wenn wir zusammenarbeiten, kommen wir größtenteils gut miteinander aus. Das ist auch nötig, denn sechs Monate zusammengepfercht auf einem Schiff können sonst schnell zu einem Höllentrip werden. Die Gäste, die wir befördern, werden sicher keinen Beitrag zu unserer Unterhaltung leisten. Die meisten gehören Spezies an, die ich bisher vielleicht einmal in meinem Leben gesehen habe und deren Sprache, wenn sie denn überhaupt eine haben, ich nicht spreche. Sie zusammen zu einem Kaffeekränzchen aus ihren Zellen herauszuholen, wäre keine gute Idee. Abgesehen davon ist es strengstens verboten.
Mittlerweile befinden sich die beiden Schiffe fast auf Rumpfkontakt. Zuerst hören wir ein Knirschen von Metall auf Metall, danach das hohle Schnappen der Andruckklemmen, die die beiden Schleusen fest miteinander verbinden. Es hallt durch das große Schiff und kommt nach einem Sekundenbruchteil als Echo zu uns zurück. Danach dauert es noch einige Minuten, in denen Automaten die Verbindung auf Luftdichtigkeit testen. Schließlich öffnet sich die Schleusentür mit einem Quietschton, der uns beiden eine Gänsehaut bereitet. Wir schweben in die Dekontaminationskammer und warten, bis die wieder einsetzende Schiffsrotation uns mit Schwerkraft versorgt und wir auf den Boden sinken.
»Stelle merken und ölen«, knurrt Herb, während metallene Tentakel uns mit einer Reihe Chemikalien besprühen, die den Mikrobenaustausch zwischen den Schiffen auf ein Minimum beschränken sollen. Den penetranten Geruch nach Altherrenhaarwasser werde ich tagelang nicht mehr aus der Nase bekommen. Es gibt Dinge, die ändern sich nie. Diese Desinfektionslauge gehört dazu.
Endlich ist die Prozedur beendet und wir schleppen unser Gepäck in die Kombüse. Hier befindet sich auch der Aufenthaltsraum, in dem wir einen Teil unserer freien Zeit verbringen, gemeinsam essen, Filme gucken oder Nachrichten sehen. Wir müssen solange warten, bis die bisherigen Wachen ihre Quartiere geräumt haben und uns ihre Dienstgeschäfte übergeben. Das dauert meist nicht länger als einige Stunden. Viel zu sagen gibt es nicht.
Es mag verwunderlich sein, daß zwei Leute genügen, um einen Frachter von knapp fünfzig Metern Länge zu fliegen und in Schuß zu halten, aber eigentlich sind selbst wir noch zu viel. Alles ist vom Größten bis ins Kleinste computerisiert, ein Umstand, der bei der rustikalen Optik der Anlage verwundert, aber die Prozessoren liegen tief im Metall und alles ist mit allem vernetzt. Überall Sensoren, stecknadelkopfgroße Kameraaugen und kleine Lichtfinger, die emsig hin- und herschwenken. Programmfehler findet und eliminiert das System gleich selbst und sollte ein Eingriff an der Hardware nötig sein, gibt es ja Herb und mich, die Schrauber.
Lisa und Van holen uns ab. Sie haben den Frachter im letzten halben Jahr in Schuß gehalten. Die Begrüßung ist kurz und wenig herzlich. Die beiden wirken müde und sind in Gedanken bereits in dem zweimonatigen Urlaub, der ihnen bevorsteht. So tauschen wir nur ein paar Floskeln aus. Der obligatorische Gang durchs Schiff zieht sich.
Die Gefangenenzellen sind fast bis auf den letzten Platz gefüllt und wir müssen wissen, wen wir befördern. So arbeiten wir uns von Zelle zu Zelle vor. Lisa erzählt uns etwas zu den jeweiligen Gefangenen, was sie getan haben, Zielplanet und bei selteneren Spezies auch etwas zu Sprache und Lebensweise. Einen Universalübersetzer haben wir auf dem Schiff nicht. Zu teuer. Also müssen wir uns behelfen können, falls einmal eine Verständigung vonnöten sein sollte.
Die wenigsten der Insassen sind menschlich. Auch daran gewöhnt man sich. Entgegen dem, was man sich in der Frühgeschichte der Menschheit unter Science Fiction vorstellte, haben die allermeisten Aliens keinerlei Ähnlichkeit mit uns. Zu unwahrscheinlich ist es selbst bei der Vielzahl unterschiedlichster Sonnen und Planeten, die unsere Galaxis bevölkern, daß das Leben zweimal auch nur einen ähnlichen Weg genommen hätte.
Die Artenklassen der Säugetiere, Reptilien, Insekten, Vögel und Fische gibt es ausschließlich bei uns auf der Erde. Nirgendwo anders hat sich der Stammbaum des Lebens genauso aufgespalten. So gibt es drei-, fünf- und sechsbeinige Spezies, sofern sie denn Beine haben und keine Tentakel, Stalaktiten oder einen Hoverantrieb. Ebenso vielfältig ist die Chemie des Lebens, was zur Folge hat, daß für jedes Volk an Bord eigene Vorräte mitgeführt werden müssen.
Gemeinsam ist ihnen allen die Intelligenz und der Drang nach Erkenntnis. Mit der Zeit lernt man, über alles andere hinwegzusehen. Das sind nur Äußerlichkeiten. Nur wenige Außerirdische sind so kriegerisch wie die Menschheit. Je länger eine Spezies existiert, desto mehr verliert sich dieser kindische Drang, überall der Stärkste und Beste sein zu wollen.
Zum Glück verbietet sich aber eine Eroberung fremder Planeten allein aus dem simplen Grund, daß die meisten der theoretisch bewohnbaren Welten für uns ungeeignete Lebensbedingungen und eine Flora und Fauna bieten, die in allen Komponenten für uns giftig ist. Nur sehr wenige Planeten sind überhaupt für eine Kolonisation nutzbar, beispielsweise weil sich dort noch kein höheres Leben entwickelt hat. Auch dort herrschen aber Lebensbedingungen, die höchstens für eine Handvoll Spezies geeignet sind und die anschließende Terraformung dauert mindestens Jahrhunderte.
So hat sich über die Jahrtausende eher eine Art interstellarer Handelszivilisation entwickelt. Alles schränkt sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner: Handel und Teilen von Wissen. Auch Abkommen über einen Gefangenenaustausch gibt es, denn Verbrecher kümmern territoriale Grenzen wenig. Bei jeder Spezies.
Ich gähne heimlich und tue so, als würde ich fleißig mitschreiben. Steht doch eh alles in der Datenbank des Schiffscomputers zum Nachlesen. Wir verlassen den Bereich für Sauerstoff-/Stickstoffatmer. Es gibt auch einige fremde Spezies, deren Stoffwechsel sich von unserem derartig unterscheidet, daß selbst freier Luftsauerstoff für sie giftig wäre. Für sie gibt es einen kleinen Extrabereich auf der HARKONNEN, in der auch Atmosphären mit Gasen vorgehalten werden, die auf erdähnlichen Planeten in freier Form nicht existieren. Wir legen die Schutzanzüge an und gehen hinein.
»Derzeit ist hier nur eine Einheit belegt«, erklärt Lisa und Van hakt wieder einen Punkt auf ihrer Liste ab. Mittlerweile bin ich mir sicher, daß sie auch nur so tut, als wäre sie aufmerksam. Wir treten vor die Zelle und blicken durch das Kraftfeld, das uns von den Insassen trennt.
Drin sitzen nebeneinander auf einer Pritsche zwei Wesen, die entfernt menschenähnlich aussehen. Zumindest besitzen sie zwei Arme und Beine an einem purpurn erscheinenden Körper, auch wenn diese geradezu grotesk lang und dünn erscheinen und in Büscheln fadenförmiger Ausläufer enden. Auf etwas, das ein Kopf sein könnte, sitzt ein großes Bündel ‘Knospen’ auf Stielen. Entfernt erinnert mich das Gebilde an die Facettenaugen mancher Insekten. Irgendwelche Körperöffnungen, die der Nahrungsaufnahme oder Kommunikation dienen könnten, entdecke ich nicht.
»Sie atmen Wasserstoff. Streng genommen sind sie pflanzlich. Die Fütterungsautomaten stellen ihnen eine Nährlösung, die sie mit den wurzelförmigen Händen und Füßen aufnehmen.«
»Wie kommunizieren sie?« frage ich.
»Sie sind Empathen oder Telepathen. Genau wissen wir das nicht. Wenn man sich hier längere Zeit aufhält, fängt man an, ihre Gefühle zu spüren und Sachen zu sehen, die nicht existieren können. Wir haben uns von ihnen möglichst ferngehalten. Ihr solltet das gleiche tun.«
Lisa klingt nervös, als sie das sagt. Anscheinend ist etwas vorgefallen, das sie zu dieser ungewöhnlich deutlichen Warnung veranlaßt.
Auf mich wirken sie gar nicht unheimlich. Eher sehen sie mit ihren dünnen Ärmchen schlaksig und zerbrechlich aus. Sie scheinen in engem Kontakt zueinander zu stehen. Ihre Gliedmaßen befinden sich in ständiger Bewegung, fast, als würden sie einander streicheln. Etwa die Hälfte ihrer Augenknospen sind einander zugewandt. Wenn ich sie länger ansehe spüre ich etwas in mir. Eine Art Echo. Wenn ich die Augen schließe, fühlt es sich freundlich an, nach Zärtlichkeit und gegenseitiger Zuneigung.
»Sind die beiden ein Liebespaar?« frage ich.
»Eher Bonnie und Clyde«, widerspricht Van. »Sie stehen auf der Fahndungsliste ihres Heimatplaneten ganz oben. Sie müssen etwas Furchtbares getan haben.«
Das ist schwer zu glauben, finde ich. Aber das entscheiden auch keine Leute wie wir. Wir führen nur Anordnungen aus und bringen sie von A nach B.
Die Führung ist beendet. Lisa und Van verabschieden sich und wir beziehen unsere Kajüten. Das Schiff ist groß, aber viel Platz gesteht man uns trotzdem nicht zu. Wir sind Inventar, keine Nutzlast. Treibstoff ist ungeachtet neuer, revolutionärer Antriebstechniken über all die Jahrtausende immer der begrenzende Faktor geblieben und die fliegenden Paläste und Städte, von denen unsere Vorfahren geträumt haben, bleiben Utopien.
Zwei Stunden geben wir uns. Dann treffen wir uns auf der Brücke. Die Gesellschaft erwartet einen Übergabebericht. Herb checkt als erstes die Reparaturlogs der vergangenen Monate. Das Ergebnis fällt nicht zu seiner Zufriedenheit aus. Ich habe nie gelernt, in seinen Gesichtszügen zu lesen, aber seine Körperbewegungen sind eindeutig, und die dumpfen, kehligen Flüche, die er in seiner Muttersprache ausstößt, muß ich dazu auch nicht verstehen.
»Wenn unsere sechs Monate durch sind, muß das Schiff ins Dock. Aber wir werden alle Mühe haben, es bis dahin zusammenzuhalten«, brummelt er danach wieder in Galaktischem Standard. »Ein paar Schotts müssen geschweißt werden, damit wir auch in ein paar Wochen noch genug Luft zum Atmen haben. Dafür waren unsere Vorgänger sich wohl zu fein. Ihr Menschen seid für solch grobe Arbeiten einfach nicht geeignet.«
Ich ignoriere den Seitenhieb. »Außerdem stimmts nicht, daß sie sie sich von den Gefangenen in der Wasserstoffsektion ferngehalten haben«, ergänze ich. »Die Schotts wurden mehrmals täglich geöffnet, seit Lisa und Van ihre Kapsel an Bord genommen haben. Was hältst Du überhaupt von ihnen? Ich muß sagen, unheimlich kommen sie mir nicht vor. Hast Du auch ihre Gefühle gespürt?«
»Nur wenig. Ich fands aber angenehm. Vielleicht verbreiten sie ja gute Laune auf dem Schiff. Dann wirds leichter, schon wieder ein halbes Jahr mit Dir zusammen durchzustehen.«
»Es fällt mir schwer, mir vorzustellen, was sie Schlimmes getan haben können. Den beiden Frauen ging es vielleicht ähnlich und jetzt schämen sie sich dafür, das zuzugeben.«
»Das ist auch nicht unser Job. Wir müssen dafür sorgen, daß der Laden läuft. Schau in die Datenbank. Da wirds drinstehen. Und jetzt laß uns diesen Bericht schreiben.«
Ein leichtes Vibrieren geht durch den Schiffsrumpf. Ich kann es spüren, wenn ich die Hand auf die Wand neben mir lege. Unser Shuttle hat abgelegt und bringt Lisa und Van zu dem Erzfrachter, der sie zur nächsten Sternbasis mitnehmen wird. Jetzt sind wir allein mit unseren Gefangenen. Nein, wir sind allein.
Die Gefangenen werden wir in den nächsten Monaten im Idealfall gar nicht zu Gesicht bekommen. Ihre Zellen funktionieren völlig autark. Für Fütterung und Hygiene ist gesorgt und wenn der Zeitpunkt der Übergabe gekommen ist, werden sie einfach aus dem Verbund ausgeklinkt, an das andere Schiff angedockt und gegen eine neue leere oder volle Zelle ersetzt. Die Einheiten besitzen sogar einen kleinen Antrieb. So kann man sie für den unwahrscheinlichen Fall einer Havarie als Rettungskapseln einsetzen. Alles für die Nutzlast. Für uns ist solch ein System nicht vorgesehen, aber zum Glück liegt die letzte Havarie im Föderationsraum auch schon einige Jahre zurück.
Der Bericht ist schnell geschrieben. Danach kehrt Routine ein. Der Frachter lenkt sich selbst zum nächsten Übergabepunkt. Nur bei der Berechnung der Hyperraumsprünge sind Herbs Geschick und Intuition gefragt. Wir klotzen ordentlich ran und haben die meisten Schäden tatsächlich bald behoben. Herb schafft es sogar irgendwie, die quietschende Schleuse zu ölen. Mit seinen Tentakeln kommt er mühelos in Ritzen und Ecken, die ich nicht einmal sehe.
Die Stimmung zwischen uns ist besser als sonst. Genau wie unsere Vorgänger besuche ich regelmäßig die beiden besonderen Gefangenen im Wasserstofftrakt. Es ist entspannend, ihren fließenden Bewegungen zuzusehen. Wenn sich die feinen Ausläufer ihrer Hände berühren, ist es, als würden dabei kleine Funken fliegen. Vielleicht besitzen sie Bioelektrizität. Auch Herb scheint es als angenehm zu empfinden. Jedenfalls ist er oft mit dabei. Wir sind uns mittlerweile sicher, daß die beiden ein Liebespaar sind und daß sie uns empathisch daran teilhaben lassen.
»Jedes Raumschiff sollte zwei von denen an Bord haben«, sagt er einmal.
Ich recherchiere in den Schiffsdatenbanken über unsere Gefangenen. Alle haben sie eine Vorgeschichte. Meist geht es um Mord und andere Gewalttaten. In einigen Fällen auch nur um schweren Betrug. Nur zu den beiden Gefangenen im Wasserstofftrakt findet sich nichts außer dieser absurd hohen Gefährlichkeitseinstufung.
»Ich werde eine Anfrage nach den fehlenden Daten funken«, sage ich zu Herb. »Vielleicht ist der Heimatplanet dieser Spezies ja gesprächiger.«
»Warg Bolton. Fettnäpfchen pflastern seinen Weg.« war nicht die Antwort, die ich hören wollte.
Natürlich hat er recht. Die Antwort besteht nur aus einem Satz.
‘Mischen Sie sich nicht in unsere inneren Angelegenheiten ein!’
Natürlich stachelt das meinen Ehrgeiz nur an. Herb verfolgt meine Anstrengungen mit seinen beiden Augenpaaren und einer Bewegung seines Kommunikationsmundes, die ich als spöttisches Grinsen interpretiere, aber wir beide haben gelernt, mit unseren Marotten zu leben. So durchforste ich in meinen freien Stunden die Wissensdatenbank der HARKONNEN nach Hinweisen auf diese mysteriöse Spezies. Leider ist die Vermittlung von Allgemeinwissen nicht Zweck der Speicherbänke.
Das meiste an vertiefendem Wissen hat mehr oder weniger mit dem Schiff und seinen Funktionen zu tun. Über unsere Insassen finde ich lediglich die Information, daß der Tag des Erstkontaktes nur wenige Jahrzehnte zurückliegt und daß die Föderation sich noch in Verhandlungen über einen Status quo befindet.
So sitze ich bei unseren Gefangenen und wünsche mir, daß eine Kommunikation möglich wäre. Die galaktische Standardschrift scheinen sie jedenfalls nicht zu beherrschen. Ich bin mehrfach mit beschrifteten Tafeln wie ein Nummerngirl vor dem Kraftfeld entlanggegangen, aber mehr als ein oder zwei ihrer Knospenaugen war ich ihnen nicht wert. Ich spüre ihre Gegenwart und vermute, daß sie meine auch spüren können. Das genügt aber nicht. Falls sie wirklich Telepathen sind, scheint das einen direkten Kontakt vorauszusetzen. Zu riskant.
Als ich frustriert in die Kombüse zurückkomme, begrüßt Herb mich mit dem Aufmerksamkeit heischenden Bewegungsspiel seiner Tentakelarme, das er immer durchführt, wenn er erregt ist oder einen seiner Alienpornos guckt.
»Du hast schon wieder die Heizung hochgedreht«, beschwere ich mich.
»Wie soll ich sonst arbeiten? Deine Kabine kannst Du gerne zu einer Kältekammer machen, aber hier habe ich auch ein Wörtchen mitzureden.«
»Dann arbeite ich ab sofort in Unterhosen«, drohe ich. Das wirkt. Seinen Körper durchläuft ein Zittern. Dann reicht er mit einem seiner Tentakel quer durch den Raum und dreht den Regler ein klein wenig zurück. Dann wendet er sich mir wieder zu.
»Wurde auch Zeit, daß Du hier erscheinst. Du verpaßt sonst das Schönste.«
»In dem Porno, den Du gerade guckst? Ist der Darstellerin ein Atombusen explodiert?«
»Sehr witzig. Das Schiff hat sich gemeldet. Sie ist der Meinung, daß wir an der nächsten Sternbasis Treibstoff aufnehmen sollten.«
»Hat sie auch eine Woche Urlaub für uns eingeplant?«
»Natürlich nicht. Aber Du hast eine Einkaufsliste erhalten. Anscheinend gibt es neueres Kartenmaterial für den Quadranten, in dem unsere nächsten Übergabepunkte liegen.«
»Detailliertere Karten? Sie betreffen nicht zufällig auch…«
»Doch.«
Am nächsten Tag erzähle ich unseren Gefangenen davon. Falls sie die Information begreifen, zeigen sie es mir nicht. Nur das Echo ihrer Gefühle in mir wird stärker. Mit jedem Tag, der vergeht, beginne ich, mich ihnen näher zu fühlen. Ich kann ihre Situation verstehen. Die beiden sind ganz allein in einer feindlichen Umwelt und fliegen einem ungewissen Schicksal entgegen. Das einzige, das sie haben, ist ihre Liebe zueinander. Tief in mir sehne ich mich auch nach solch einem absoluten Glück, wissend, daß meine eigene Spezies dafür nicht geschaffen ist.
Eine Warnung von Van trudelt in meinem Postfach ein. ‘Seid vorsichtig mit Bonnie und Clyde. Lisa wollte ausprobieren, ob sie Telepathen sind und hat sie angefaßt. Sie ist beinahe gestorben. Die beiden sind elektrischer als Zitteraale!’
Auf der Sternbasis tauschen wir zunächst einige Gefangenenzellen aus. Wir geben ihnen mehrere Zellen mit quallenartigen Wesen, die im Wasser leben. In dem, was auf ihrem Planeten Wasser ist. Es enthält große Mengen an Schwefelwasserstoff und Arsen. Dafür erhalten wir einige Individuen einer radialsymmetrischen Spezies, die aussehen wie eine Kreuzung aus Wagenrädern und Mühlsteinen. Sie bewegen sich, indem sie ihren Körper verformen und rollen. Ihre Stimmen klingen schrill und wenig harmonisch. Ich finde sie unangenehm und bin froh, daß ich mich nicht weiter mit ihnen befassen muß.
Später besorge ich die nötigen Daten für unser Schiff. In der restlichen verbleibenden Zeit, bis wir wieder starten, führe ich einige Videocalls zur Heimatbasis. Nele, meine Frau ist überrascht, daß ich mich so schnell schon melde. Ich erkläre die Situation. Sage ihr, daß sie mir fehlt, auch wenn das nur ein Teil der Wahrheit ist.
»Vielleicht ist das Dein letzter Einsatz im All«, sagt sie und strahlt mich an. »Eigentlich wollte ich bis Heiligabend warten, ehe ich es Dir erzähle. Du hast jetzt genügend Dienstjahre angesammelt. Vater sagt, er kann Dich in der Administration unterbringen. Dann müßtest Du viel seltener weg. Was meinst Du dazu?«
Ich verstehe ihre Freude, auch wenn ich ihren Traum nicht teile. Ich würde unseren nächsten Lebensabschnitt viel lieber auf der Koloniewelt Terra Nova verbringen. Die Terraformung ist dort schon weit fortgeschritten.
Das sage ich ihr aber nicht. Sie würde es nicht verstehen. Nele hat die Erde in ihrem ganzen Leben nie verlassen. Nicht einmal die Stadt, in der sie geboren wurde. Sie hat nicht mein Bedürfnis nach unverbrauchter Luft und freiem Himmel über uns. Sie würde auch nie verstehen, was ich daran finde.
Wir unterhalten uns noch eine Weile über Belanglosigkeiten. Schwiegervater hat uns eine größere Wohnung besorgt. Jetzt brauchen wir neue Möbel. Ich sage ihr, sie wird das schon machen. Dann verläßt sie kurz den Raum und kommt mit den beiden Kleinen zurück. Sie waren gerade eingeschlafen und blinzeln mit ihren Kuscheltieren müde in die Kamera.
Ich verteile einige Liebkosungen und beende dann das Gespräch. Ich ertrage diese Nähe jetzt nicht.
Einen Anruf habe ich noch auf der Liste: Helena, eine Freundin aus dem Studium. Sie arbeitet jetzt am Institut für Astroethnologie und ich hoffe, daß sie die fehlenden Informationen über unsere pflanzlichen Gäste für mich besorgen kann. Ich schildere ihr mein Problem. Sie nickt verständnisvoll.
»Die neue Wasserstoffspezies sagst Du? Wir wissen tatsächlich nicht viel über sie. Mach Dir also keine großen Hoffnungen. Ich werde aber den Botschafter interviewen, der kürzlich von den Status-quo-Verhandlungen zurückgekommen ist. Das wollte ich sowieso tun. Vielleicht weiß er etwas. Ach ja, und schick mir Bilder der beiden.«
Einige Stunden später befinde ich mich wieder auf dem Schiff. Die Tanks sind voll. Ich bin im Besitz des Sticks für den Schiffscomputer. Da auf dieser Basis auch einige Menschen arbeiten, durfte ich sogar etwas frisches Gemüse aus ihren hydroponischen Gärten mitnehmen. Bei einem der Händler konnte ich weitere Lebensmittel einkaufen, die nicht auf dem Speiseplan stehen, den die Gesellschaft uns zubilligt. Als der Geruch von gebratenem Wasabufleisch durchs Schiff zieht, einem der wenigen Lebensmittel, das für uns beide gleichermaßen verdaulich ist, ist Herb sofort da.
»Wies aussieht, hast Du mit Deiner Zeit etwas nützliches angefangen«, begrüßt er mich.
»Hat ein kleines Vermögen gekostet. Genieße es.«
Er schaufelt das Fleisch mit den Tentakeln in atemberaubender Geschwindigkeit in seinen Eßmund. Ich mache mir Sorgen, daß er in seiner Gier die Spitzen der Tentakel abbeißt, denn der Mund trägt mehrere Reihen spitzer Zähne, aber ich weiß, daß er mir dankbar ist. Er überläßt mir dafür die weniger dreckigen Jobs. Besonders viele Karmapunkte sammle ich bei ihm mit einem neuen Porno. Ich drücke ihm den Chip nach dem Essen in die Hand und sehe, wie seine Augenpaare leuchten. Dann gehe ich auf die Brücke und installiere das Kartenupdate.
Es dauert eine Weile, bis das Schiff die neuen Daten in sein System konvertiert hat. Die Zeiten, in denen man Datenmengen noch in Byte messen konnte, sind lange vorbei. Es gibt lediglich verschiedene Abstufungen von ‘gigantisch groß’. Endlich erscheint die Arbeitsoberfläche wieder und ich zoome in den neuen Kartenausschnitt hinein.
Die Karten sind viel schärfer als das alte Material. Es handelt sich um einen Sternenstrom am Rande der Galaxis. In den letzten Jahrhunderten waren dort noch keine bewohnten Welten verzeichnet. Daher lag die Karte nur in geringer Auflösung vor. Das ist anders, seit wir Kontakt mit der Wasserstoffspezies haben. Gewohnt schnell und scharf baut sich das Bild auf, das die Photodrohnen in den letzten zehn Jahren akribisch aufgezeichnet haben. Einige Artefakte im Bildmaterial zeigen mir aber, daß die Drohnen besser noch einige Runden geflogen wären.
Schnell habe ich das fragliche Sonnensystem ausgemacht. Es ist mit einem purpurnen Sternchen markiert. Das steht für ‘Wasserstoffatmer, für Menschen ungeeignet’. Ich scrolle hinein und finde einen Stern vom K-Typ, der von nur einem inneren Planeten in Marsgröße umkreist wird. Der befindet sich am äußersten Rand der Zone, die der Computer als habitabel für dieses System ausweist. Ich zoome weiter hinein und die physikalischen Daten werden angezeigt:
Durchmesser 9,000 km
Schwerkraft 0,7 g
Planetares Magnetfeld ca. 200 µT
Mittlere Oberflächentemperatur 281 K
Ausgeprägter Vulkanismus
Atmosphäre 30% Wasserstoff, 65% Kohlendioxid, 5% Methan und Edelgase
Hydrosphäre (15% der Oberfläche) bestehend aus kleinen Meeren und Seen mit hohem Phosphatgehalt
Satelliten: keine
Intelligentes Leben: ja
Das Besondere an dieser Welt ist ihr starkes Magnetfeld, das weit über die Atmosphäre hinausreicht und verhindert, daß sie vom Sonnenwind einfach ins Weltall geblasen wird. Eine Unterscheidung in pflanzliches und tierisches Leben scheint im Verlauf der Entwicklung nicht stattgefunden zu haben. Alle Lebensformen auf der Oberfläche gewinnen ihre Energie mehr oder weniger aus Sonnenlicht und dichte purpurfarbene Wälder bedecken die Breiten in der Nähe des Äquators.
Der Treibhauseffekt durch das Kohlendioxid und Methan in der Atmosphäre hält die Temperatur beinahe auf Erdniveau, obwohl dieser Planet viel weniger Strahlung von seiner Sonne erhält. Für Menschen ist diese Welt geradezu atemberaubend fremdartig und ein Beweis, daß die Kraft der Evolution auch an sehr ungewöhnlichen Orten wirkt.
Mehr finde ich leider nicht. Informationen über Ethnologie und Kultur sind in solchen Karten üblicherweise nicht enthalten. Da muß ich auf Helena hoffen.
Mittlerweile haben wir den schmalen Spalt am Rande der Galaxis durchstoßen und befinden uns innerhalb des Sternenstroms, in dem der nächste Übergabepunkt liegt. In den kurzen Pausen zwischen unseren Hyperraumsprüngen können wir die Linse unserer Heimatgalaxis in ihrer ganzen Pracht überblicken. Sie wirkt viel heller, als ich es von der Erde gewohnt bin. Vielleicht ist aber auch nur alles andere viel dunkler. Der Sternenstrom ist im Vergleich zu dünn, als daß er optisch ins Gewicht fiele. Daher ist eine Hälfte des Himmels pechschwarz. Nur einige unserer Nachbargalaxien hängen in der Schwärze des Alls wie überdimensionale Traumfänger herum.
Auffällig ist, daß es hier gleich mehrere Planeten mit für Wasserstoffatmer geeigneten Lebensbedingungen zu geben scheint. In der gesamten restlichen Galaxie gibt es nur eine Handvoll. Der Strom hat eine andere Geschichte als die Milchstraße. Er ist der Rest eines größeren Sternhaufens oder einer Zwerggalaxie, die vor langer Zeit vom Schwerefeld unserer eigenen Galaxie eingefangen wurde.
In den nächsten Tagen bekommen wir wieder viel zu tun. Es gibt Streit im Gefangenenbereich. Die Wesen mit dem Aussehen von Mühlsteinen fühlen sich nicht angemessen behandelt. Ihre Zellen liegen ihnen im Trakt zu weit auseinander. Ihre hohen, pfeifenden Stimmen sind schon bei normaler Lautstärke für die meisten hörenden Spezies nur schwer erträglich. Jetzt, wo sie über ein Dutzend Zellen Entfernung miteinander kommunizieren, klingt es wie in einem Paviangehege bei der Fütterung. Bevor sie zu schreien beginnen, pumpen sie ihren Körper so sehr mit Luft auf, daß sie beinahe kugelförmig erscheinen. Wenn sie dann loslegen, erzeugen sie mühelos eine Lautstärke wie die Antriebsdüsen des Frachters beim Start von einem Planeten.
Wir halten uns von diesem Streit möglichst fern. Normalerweise regeln die Insassen der Zellen das untereinander. Als die Vitalwerte einiger besonders empfindlicher Gefangener aber bedrohlich absinken, müssen wir doch einschreiten. Wir starten eine Bäumchen-wechsel-Dich Runde und versetzen die Zelleinheiten solange gegeneinander, bis die Schreihälse sich ganz am Ende des Traktes befinden und die Türseiten mit den Kraftfeldern von den anderen weg nach außen weisen. Fast einen ganzen Tag dauert diese Aktion und wir befinden uns bereits tief in dem Sternenstrom, als sie endlich beendet ist.
Mittlerweile ist Helenas Antwort über Hyperfunk hereingekommen. Sie schickt eine Nachricht mit einer Reihe angehängter Dokumente.
‘Lieber Warg,
danke für die Bilder.
Ich habe mit dem Botschafter gesprochen. Dein Gespür für unangenehme Situationen war schon immer ausgezeichnet. Schön, daß Du mich daran teilhaben läßt.
Es gestaltete sich schon problematisch, überhaupt zu ihm vorzudringen. Seine Gesundheit ist sehr angegriffen, weil er sich monatelang nur in einem Schutzanzug aufhalten konnte. Die Enewah, so lautet der Name, mit dem die Wasserstoffatmer sich bezeichnen, bestehen nämlich darauf, daß die Verhandlungen auf ihrer Planetenoberfläche stattfinden. Raumfahrt haben sie keine entwickelt und scheinen auch kein Interesse daran zu haben. Allerdings haben sie einige unserer Frachter für ihre Zwecke umgebaut und nutzen sie, um Metalle zu importieren, die bei ihnen selten sind. Auf diese Art haben vermutlich auch Deine Gefangenen den Planeten verlassen.
Ihre Haltung uns gegenüber ist abweisend, ebenso wie die Haltung des Botschafters mir gegenüber. Da ihre empathischen Fähigkeiten nicht nur empfangender, sondern auch sendender Natur sind, haben sie den Botschafter daran ausgiebig teilhaben lassen. Diese unfreundliche Umgebung über viele Wochen hat sein Nervenkostüm stark in Mitleidenschaft gezogen. Entsprechend gestreßt hat er sich mir gegenüber verhalten. Nach meiner unmaßgeblichen Meinung ist er reif für ein Sanatorium.
Über die Verhandlungen habe ich nichts erfahren, außer daß sie sich sehr in die Länge ziehen. Einiges funktioniert schon ganz gut, aber daß es zu funktionierenden Handelsbeziehungen auf der Basis von gegenseitigem Verständnis kommt, werden wir zwei wohl nicht mehr erleben. Dazu ist ihre Kultur zu fremdartig.
Ich erhielt lediglich eine Reihe Dokumente. Die Enewah haben einiges für uns in Galaktisches Standard übersetzt. Leider sind die Texte für uns deswegen noch nicht verständlich. Das Wichtigste scheint ihnen ein Buch-der-Familie zu sein, eine Art Doktrin, nach der sie leben. Wir werden einige Zeit benötigen, uns in die Denkweise hineinzuversetzen und den Inhalt zu verstehen. Aufschlußreicher finde ich eine Reihe Anmerkungen des Botschafters. In ihnen steht wohl das, was Du wissen willst. Ich habe sie Dir beigelegt. Viel Spaß damit.
Vielleicht läßt es sich einrichten, daß Du mich über das, was Du da planst, auf dem Laufenden hältst. Wenn Du aber in der Zukunft wieder einmal solch eine Aufgabe hast, suche Dir bitte jemand anderen. Danke.
Helena’
Es sieht so aus, als müßte ich mich bei ihr entschuldigen. Ich schreibe eine lange Nachricht, schicke sie aber nicht ab, weil mir nicht genügend passende Worte einfallen wollen. Diplomatie ist nicht meine Kernkompetenz. In den nächsten Stunden arbeite ich mich durch die Dokumente. Der Botschafter tut mir leid, wenn er beschreibt, wie schwierig es ist, sich jeden Tag wieder neu aufzuraffen und der Ablehnung mit freundlicher Entschlossenheit gegenüberzutreten. Das muß ihn aufgezehrt haben und steht in schroffem Gegensatz zu dem Verhalten, das unsere beiden Gefangenen zeigen.
Manchmal denke ich, er schreibt über ein völlig anderes Volk. Er erklärt, wie die Verhandlungen ablaufen. Die Enewah treten ihm gegenüber immer paarweise auf und stehen zu jedem Zeitpunkt miteinander in Körperkontakt. Es sind immer ein männliches und ein weibliches Exemplar. Die jüngeren Paare stehen nur in loser Verbindung. Die älteren scheinen an verschiedenen Körperteilen miteinander verwachsen zu sein und aus ihren unteren Körperregionen sprießen dann eine Art Schößlinge, die sich vermutlich später zu selbständigen Individuen entwickeln.
Der Botschafter fragt einmal nach, ob er richtig vermutet. Die Reaktion ist wie gewohnt schroff. Anscheinend sind die Enewah aber trotz ihrer generellen Unfreundlichkeit bemüht, etwas guten Willen zu zeigen, denn er erhält nach einigen Tagen eine Antwort auf seine Frage. Nach ihrer Darstellung trennen sich die ‘Schößlinge’ in ihrer Jugend von den Eltern ab, ein Vorgang, der als sehr schmerzvoll für beide Seiten beschrieben wird.
Sie bleiben nur kurz allein und verbinden sich schnellstmöglich mit einem Jugendlichen des anderen Geschlechts, mit dem sie bis an ihr Lebensende beisammenbleiben. Überzählige weibliche und männliche Exemplare, die keinen Partner finden und so die Reinheit-der-Familie gefährden, werden exekutiert. Das komme aber nur ganz selten vor, weil das Zahlenverhältnis zwischen den Geschlechtern sehr ausgewogen sei. Die Reinheit-der-Familie stehe über allem und niemand würde das Buch-der-Familie in Frage stellen.
Das letzte Dokument enthält eine Reihe von Bildern, die während der Verhandlungen aufgenommen wurden. Ich überfliege sie und erstarre innerlich. Tatsächlich treten die Enewah immer paarweise auf. Die beiden Geschlechter, die sich zu einer Partnerschaft zusammenfinden, sehen aber so grundverschieden aus, daß mir sofort klar ist, daß es sich bei unseren Gefangenen um Angehörige desselben Geschlechts handelt.
»Ja und?« ist Herbs Reaktion, als ich ihm das beim Frühstück erzähle. »Du willst mir doch nicht erzählen, daß sie zur Fahndung ausgeschrieben wurden, nur weil sie homosexuell sind?«
»So siehts aus. Und auf ihrem Planeten werden sie exekutiert werden.«
»Manchmal hasse ich meinen Job.«
Urplötzlich gellen Alarmsirenen los. Ein schwerer Schlag erschüttert das Schiff. Die Lampen erlöschen und die rote Notbeleuchtung geht an. Wir stürzen auf die Brücke und sehen die Bescherung. Vor der Fensterfront der Brücke schwebt träge ein Felsbrocken von mehreren Metern Durchmesser. Er hat wohl gerade nähere Bekanntschaft mit der Schiffshülle gemacht.
»Fuck, wie konnte das passieren?« Herb ist außer sich und seine Tentakel vollführen einen hypnotischen Wirbel vor meinen Augen. »Schau auf das Radar. Da sind noch mehr davon. Viel mehr!«
Ich vergleiche die Schiffskarte mit der Realität. Wir befinden uns in einem Asteroidenfeld, das zu einem Zwergstern gehört. Nur ist die Karte an dieser Stelle leer.
»Ich hatte schon beim Einlesen der Karte das Gefühl, daß sie nur mäßig genau ist und die Drohnen hauptsächlich die bewohnten Bereiche des Stroms abgeflogen sind.«
»Aber sie können doch nicht ein komplettes Sternsystem übersehen!« Herbs Stimme ist kurz vorm Überschnappen und erinnert mich für einige Sekunden an die Laute der Mühlsteine, die uns den letzten Tag in Atem gehalten haben.
»Sieht so aus, als können sie doch.«
Wir sichten den Schaden. Die Schilde der HARKONNEN haben unsere unmittelbare Zerstörung verhindert, aber die Gefahr ist noch lange nicht vorbei. Weitere Felsbrocken befinden sich im Anflug. Springen können wir nicht. Zu viel Bewegung um uns herum. Um hier korrekte Parameter zu berechnen, besitzt der Computer nicht genügend Leistung. Das einzige, was möglich ist, ist, in langsamer Fahrt aus den Asteroiden hinaus zu manövrieren. Ich lasse einen Kurs berechnen, der möglichst wenige weitere Kollisionen beinhaltet – ganz können wir es nicht verhindern – und beschleunige das Schiff auf langsame Fahrt.
»Sieht so aus, als wäre das neue Kartenmaterial verwanzt«, fluche ich. »Manchmal hasse ich es, recht zu haben.«
»Ich bereite mich schon mal auf die Reparaturen vor.« Herb hat sich in Rekordtempo abgeregt und wirkt jetzt gelassener, als ich mich fühle.
»Ich stoße dazu, sobald wir aus der Gefahrenzone sind.«
Das dauert einige Stunden. Mehrere, weitere Kollisionen müssen wir noch überstehen. Sie sind nicht mehr so schlimm wie die erste und die Schilde halten ihr stand. Wären die Felsbrocken so massiv, wie sie aussehen, stünde es jetzt schlecht um uns. Glücklicherweise bestehen die meisten der Geschosse zum größten Teil aus Wasser, Staub und Trockeneis und zerstieben beim Aufprall auf die Schilde zu einer schmutzigen Wolke, die uns die Sicht nimmt. Ohne das Radar wären wir heute aufgeschmissen.
Die Erschütterungen setzen uns aber dennoch schwer zu. Die Alarmlichter an den Andockringen für die Gefangenenzellen werden zahlreicher. Die Hecksektion mit den Lagerräumen dekomprimiert. Zum Glück halten die frisch geschweißten Schotte. Nach einer gefühlten Ewigkeit leert sich das Radar wieder. Wir scheinen genügend Abstand zu diesem Zwergstern gewonnen zu haben. Ich stoppe die Maschinen.
Die nächsten 24 Stunden arbeiten wir durch. Zunächst gilt es, die nicht dekomprimierten Bereiche auf Dichtigkeit durchzumessen. Danach stabilisieren wir die Zellen der Gefangenen. Einige hat es während der Katastrophe erwischt. Sie haben sich vom Schiff gelöst und trudeln irgendwo draußen zwischen den Felsen herum. Ihnen können wir nicht mehr helfen. Die meisten können wir aber retten. Sobald die Magnetklemmen, die sich gelöst haben, wieder Strom erhalten, sichern sie die Zellen und die roten Lämpchen auf der Brücke verschwinden eine nach der anderen. Die Wasserstoffsektion scheint sogar völlig unversehrt zu sein.
Als nächstes sitzen wir gemeinsam auf der Brücke und stellen Informationen zusammen für den Bericht an die Gesellschaft. Die Sonne, die sich nicht auf der Karte befindet, hat eine Menge Schaden angerichtet. Zum Glück stehen die Sterne hier draußen so dünn, daß eine Wiederholung dieses Unfalls extrem unwahrscheinlich ist. Nachdem wir in einigen Tagen die gröbsten Schäden beseitigt haben, können wir relativ gefahrlos weiterfliegen.
Herb darf als erster schlafen. Momentan ist es besser, wenn immer einer Wache hält. So sitze ich mit einem großen Becher synthetischen Kaffees auf der Brücke und behalte alles im Auge. Das Schiff scannt derweil systematisch die Umgebung und fügt sie unserem Kartenmaterial hinzu. Besser spät als nie. Nach einigen Stunden, ich bin gerade dabei, wegzunicken, blinkt plötzlich ein purpurnes Sternchen auf der Umgebungskarte auf. Mit einem Schlag bin ich wieder wach. Offensichtlich hat dieser Stern Planeten und einen von ihnen hat die Software gerade als geeignet für Wasserstoffatmer klassifiziert!
Ich weise den Computer an, die Parameter dieser Welt genauer zu analysieren. Es handelt sich nicht gerade um einen Zwilling des Heimatplaneten der Wasserstoffatmer aber die Ähnlichkeit ist groß genug, um… ich beginne, einen Plan zu schmieden. Nachdem auch meine Schlafphase vorüber ist und ich mir sicher bin, daß ich mir in meiner Müdigkeit nichts zusammengesponnen habe, rede ich mit Herb.
»Das läßt Dir keine Ruhe, was?« grinst er mich mit seinem zahnlosen Kommunikationsmund an.
»Gibs zu, daß sie unser Liebespaar so einfach um die Ecke bringen wollen für etwas, für das sie nichts können, paßt Dir auch nicht.«
»Klar paßt mir das nicht. Aber Du machst grad wieder den Job anderer Leute.«
»Nur, wenn Du es mitträgst.«
»Na los, mach schon. Frag sie.«
Ich lade ein Tablet mit den Daten des Planeten, seiner Schwerkraft, Masse, Atmosphäre und Temperatur. Hoffentlich funktioniert meine Idee und die beiden Enewah verstehen doch genügend Galaktisches Standard, damit ihnen unser Vorschlag klar wird. Dann schlüpfe ich in den Schutzanzug und betrete den Bereich unserer verliebten Gäste.
»Hey!« rufe ich laut, in der Hoffnung, sie damit auf mich aufmerksam zu machen, und halte ihnen das Tablet durch eine Lücke im Kraftfeld entgegen.
Zuerst passiert nichts. Die beiden sitzen mir eng umschlungen gegenüber. Ich rufe noch einmal und plötzlich wenden sich einige ihrer Knospenaugen mir zu. Einer der beiden streckt mir zögernd einen seiner langen Arme entgegen und berührt das Tablet. In der Sekunde, in der er es nimmt, durchfährt mich ein heftiger, elektrischer Schlag. Gleichzeitig spüre ich aber die die Emotionen, die die beiden füreinander haben, so intensiv, fast, als wäre ich ein Teil davon, als würde ihre Freundlichkeit mich mit einschließen.
Ein wunderbares Gefühl ist das. Anscheinend verbessert körperlicher Kontakt den empathischen Empfang, auch wenn es nur durch den Umweg über einen Gegenstand ist. Dann, nach einigen viel zu kurzen Sekunden, bin ich wieder allein in meinem Kopf. Die beiden konzentrieren sich auf das Display, ohne ihren körperlichen Kontakt dabei auch nur für eine Sekunde zu unterbrechen.
Mir wird klar, daß das gerade übel hätte ausgehen können. Van hat mich vor der elektrischen Ladung der Enewah gewarnt und ich habe nicht daran gedacht. Mein ganzer Arm kribbelt und die Finger fühlen sich taub an. Nach einigen Sekunden wird es wieder besser. Vielleicht handelt es sich nur um eine Begleiterscheinung ihrer ungewöhnlichen Kommunikationsform. Lebensbedrohlich fühlt sich der Schlag jedenfalls nicht an.
Ich warte. Lange Zeit geschieht nichts. Dann befindet sich plötzlich eine neue Emotion im Raum. Der andere der beiden reicht mir das Display zurück. In dem Augenblick, in dem wir beide es halten, durchfährt mich erneut ihre Elektrizität, immer noch stark, aber nicht mehr so schmerzhaft, wie beim ersten Mal. Diesmal sehe ich auch Funken um das Tablet sprühen. Parallel zeigen mir die beiden wieder ihre Gefühle. Ich spüre jetzt Freude neben ihrer nie versiegenden Liebe zueinander. Überwältigende, große Freude.
Ich berichte Herb von meinem Erlebnis. »Hoffentlich ist das ihre Art, ‘ja’ zu sagen,«. knurrt er. »Dann laß uns mal loslegen.«
Wir setzen Kurs auf den Planeten und bereiten uns vor, die Kapsel in seiner Atmosphäre auszusetzen. Ihre Hilfstriebwerke werden für eine sichere Landung sorgen. Unten angekommen wird sich das Kraftfeld abbauen und die beiden freilassen. Die Nahrungsvorräte werden sie vermutlich nicht mehr brauchen, wenn sie erst unten sind, denn passend mineralhaltiges Wasser gibt es genügend.
Wir stehen beide am Andockring, als ich die Magnetklammern abschalte. Die Kapsel löst sich und schwebt durch eine Lücke in den Schilden dem Planeten entgegen. In dem Moment, als sie ganz dicht vor unseren Sichtluken vorbeifliegt, spüren wir zum letzten Mal eine Emotion, die uns unsere pflanzlichen Freunde senden. Sie breitet sich in unserem Innern aus und durchflutet uns mit … diesmal ist es eindeutig Dankbarkeit. Wieder dauert das Gefühl viel zu kurz an. Als es verebbt, bleibt nur die Leere, die ich seit einigen Wochen spüre, wenn ich mit mir allein bin. Kein schönes Gefühl. Ich hoffe, es wird auch wieder verschwinden.
»Mir scheint, sie verabschieden sich von uns«, sage ich. »Das ist wohl ihre Art Lebewohl zu sagen.«
Tief in Gedanken gehen wir beide auf die Brücke zurück. Ich füge die Wasserstoffatmer-Kapsel der Verlustmeldung hinzu. Unsere Freunde sind jetzt sicher. Niemand wird sie hier suchen. Dann bereiten wir uns auf den Rückflug zur nächsten Sternbasis vor.
»Weißte, was heute für ein Tag ist?« fragt mich Herb, als wir später beisammensitzen und einen Spielfilm gucken.
»Keine Ahnung. Ich habe völlig das Zeitgefühl verloren.«
»Ich meine nicht den galaktischen Standardkalender. Auf der Erde ist jetzt der 24. Dezember. Für euch Menschen ist heute Heiligabend.«
»Du weißt Sachen«, sage ich verblüfft.
»Fremde Kulturen sind eines meiner Hobbys. Und … na ja, und so ganz fremd bist Du mir ja nicht.«
Ich erröte und denke, daß ich keine Ahnung habe, was für ein Feiertag jetzt möglicherweise auf Herbs Welt ist.
»Ich habe das Gefühl, daß uns der Kontakt zu den beiden Enewah verändert hat. Vielleicht sind wir Freunde geworden. Nach all den Jahren.«
»Ich glaube, wir kennen uns einfach besser. Du hast mir früher nie etwas mitgebracht.«
»By-the-way«, lenke ich ab, ehe die Situation zu gefühlsduselig wird, »ob unsere neuen Freunde dort draußen glücklich werden?«
»Wir werden es nie erfahren, aber ich bin mir sicher, daß wir das richtige getan haben.«
»Ich auch. Frohe Weihnacht, Herb.«
»Frohe Weihnacht, mein Freund.«
von
Schlagwörter:
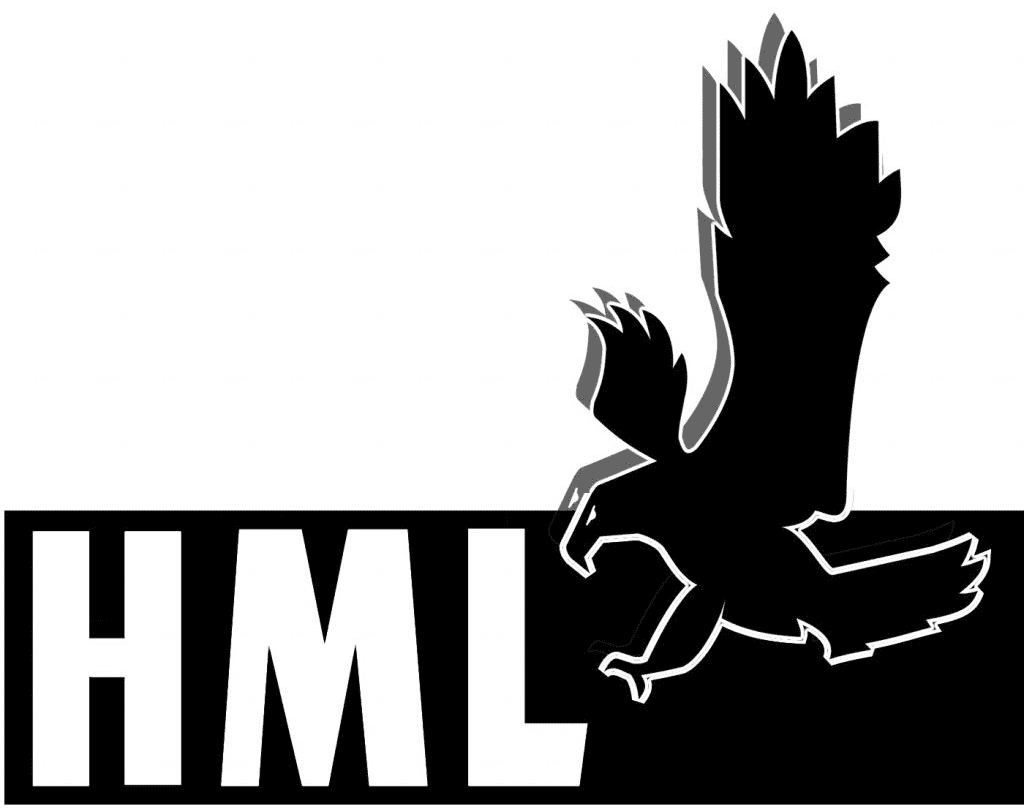

Kommentar verfassen